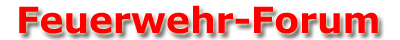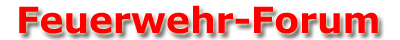Thema: Radsynchronisation - vieviele Auspuffschläge?
Autor: .
Datum: 02.03.2005 12:53
Hallo Tilmann,
ich habe die Email, die ich Dir schreiben wollte, hier nun eingestellt. Leider sind die gesamten Formatierungen des Textes verlorengegangen.
zu Deiner ersten Frage:
Warum müssen Dampflokomotiven doppelt wirkende Zylinder haben?
1. Jeder Kurbeltrieb hat konstruktionsbedingt zwei Totlagen, wenn sich der Kolben in der Endlage befindet.
2. Jede Lokomotive muss selbständig anfahren können.
3. Daraus folgt: eine Lokomotivemaschine darf keinen Totpunkt besitzen, weil sie sonst nicht anfahren könnte.
Die einfachste und beste Lösung war der Kurbelversatz von 90°, das heißt, wenn ein Zylinder in der Totlage stand erzeugt der andere sein maximales Drehmoment. Wenn wir aber insgesamt 360° abdecken wollten, brauchen wir logischerweise 360° : 90° gleich 4 einfach wirkende Zylinder. Um nun zwei Zylinder verwenden zu können, hat man die Zylinder doppelt wirkend gebaut, übrigens gleich von Anfang an. Die Stephensonsche Rocket hatte auch schon doppelt wirkende Zylinder.
Lokomotiven mit einfach wirkenden Zylinder gibt es nicht, weil diese aus den oben anführten Ausführungen mindestens vier Zylinder zum Anfahren benötigen würden. Ich kenne keine und habe auch in der Literatur nichts gelesen.
Nach meinen Kenntnissen waren Omnibuslokomotiven ? zumindest die preußischen ? mit ganz konventionellen Triebwerken ausgerüstet und nicht mit Dampfmotoren.
Die von Dir erwähnte 19 1001 hat vier Zweizylinderdampfmotoren in V-Form mit zwei doppelt wirkenden Zylindern, nachzulesen im Buch über die 19 1001. Die Lokomotive mussten ja auch selbst anfahrend sein ? siehe oben.
zu Deiner zweiten Frage. Zuerst Deine Feststellung:
Eine zweizylindrige Dampfmotorlok mit Verbundwirkung hat demzufolge nur einen Auspuffschlag pro Radumdrehung.
Du erwähnst die bayrische ML 2/2. Diese Lokomotive wird zwar in der Literatur als ?Motorlokomotive? bezeichnet, ist aber im Prinzip keine, denn sie hat ein konventionelles Triebwerk, allerdings für Deutschland unüblich ein Innentriebwerk mit einer zweizylindrigen Verbundmaschine.
Damit taucht wieder die Frage nach der Anzahl der Aufpuffschläge pro Radumdrehung bei Verbundmaschinen auf. Ich habe oben schon ausgeführt, dass Zweizylinderlokomotiven doppelt wirkende Zylinder brauchen, um anfahren zu können. Wenn nun bei der Verbundmaschine nur ein Zylinder den Dampf in das Blasrohr entlässt, treten deshalb immer 2 Auspuffstöße pro Radumdrehung auf. Ein Stoss ist absolut nicht möglich.
zu Deiner 3. Frage:
In diesem Punkte gebe ich Dir recht: es wäre vernünftiger, von einfacher und zweifacher Dampfdehnung zu sprechen und bitte deshalb um Nachsicht, weil ich als Praktiker die Triebwerksbezeichnung h2 mit als ?Hochdruck? bezeichnet habe, es aber ?Heißdampf? bedeutet. Ich werde künftig den Begriff der Dampfdehnung benutzen
Zu Deiner letzten Frage:
Warum sind die Zweizylinder Verbundmaschinen den Hochdruckmaschinen hoffnungslos unterlegen?
Um das zu verstehen, hilft eine kleine Rechnung. Die Leistung einer Drehbewegung ist
P = M x ω
wobei
M das Drehmoment F x r (Kurbelradius)
und
ω die Winkelgeschwindigkeit 2π x n (Drehzahl) ist.
Damit ergibt sich
P = F x r x 2π x n
Wir betrachten nun die Kraft F, die im Zylinder erzeugt wird. Sie ist
F = Δp x A
wobei
Δp das Druckgefälle im Zylinder
und
A die Kolbenfläche ist.
Durch das Profil der Eisenbahn können die Zylinderdurchmesser nur bis einer maximalen Größe gebaut werden und der liegt bei uns bei 600 mm. Um die Leistung auf bei Zylinder gleichmäßig zu verteilen, muss das Druckgefälle zwischen Hochdruck- und Niederdruckzylinder etwa 1:2,5, das heißt bei einem Kesseldruck von 10 bar der Druck im Hochdruckzylinder um 6 bar, im Niederdruckzylinder um 4 bar abgebaut. Damit ergibt sich ein Hochdruckkolbendurchmesser von 490 mm.
Daraus resultieren folgende Kolbenkräfte:
Fh = 6 x 2π x 492
Fn = 4 x 2π x 602
oder
Fg= 2π ( 6 x 2400 + 4 x 3600)
Fg = 2π (14400 + 14400)
Fg = 181 kN
Bei gleichen geometrischen Abmessungen betragen die Kolbenkräfte:
Fg = 2 x 2π(10 x 3600)
Fg = 452 kN
Man erkennt daraus sehr deutlich, dass die Zylinderkräfte einer Dampfmaschine mit einfacher Dampfdehnung deutlich größer sind als die einer Verbundmaschine, vorausgesetzt man wählt die maximal möglichen Kolbendurchmesser.
Um Deiner weiteren Frage, warum man dann Verbundmaschinen gebaut hat, vorzubeugen, muss gesagt werden, dass Verbundmaschinen zur Zeit des Nassdampfes gebaut wurden und die Verbundmaschine im Vergleich zu einer leistungsgleichen Maschine mit einfacher Dampfdehnung des besseren Wirkungsgrad hatte und damit weniger Wasser und Kohlen gebraucht hat.
So, nun hoffe ich, Deine Fragen erschöpfend beantwortet habe und verbleibe mit
herzlichen Grüßen
Holger
|